Wegweisendes IGH-Gutachten: Internationaler Gerichtshof ebnet Weg für Länderklagen wegen Klimafolgen
Der IGH in Den Haag erklärt den Klimaschutz zur völkerrechtlichen Pflicht und nimmt damit auch die Energiepolitik und Energiewirtschaft ins Visier. Die Anerkennung einer sauberen Umwelt als Menschenrecht eröffnet neue rechtliche Möglichkeiten und stellt einen Meilenstein im internationalen Klimarecht dar: Staaten könnten einander künftig zur Verantwortung ziehen, auch nationale Gerichte könnten angerufen werden. Nach Auffassung des IGH könnten vom Klimawandel betroffene Länder künftig Anspruch auf Entschädigung haben, über deren Höhe sei im Einzelfall zu entscheiden.
Klimawandel und Völkerrecht: IGH erklärt saubere Umwelt zum Menschenrecht und fordert Emissionsminderung
Am 23. Juli 2025 hat der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag seine mit Spannung erwartete „Advisory Opinion“ zu den völkerrechtlichen Pflichten von Staaten im Kampf gegen den Klimawandel vorgelegt. In dem Gutachten wird die Bedeutung einer „sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt“ als fundamentales Menschenrecht hervorgehoben – eine Premiere in der Geschichte des internationalen Rechts. Die über 500 Seiten umfassende Stellungnahme war von dem durch den Klimawandel bedrohten Inselstaat Vanuatu im Südpazifik initiiert worden, 130 Staaten haben sich der Aufforderung angeschlossen.
Im Zentrum der IGH-Stellungnahme steht die verpflichtende Emissionsminderung, nicht nur auf Grundlage des Pariser Klimaabkommens, sondern auch auf Basis des Völkergewohnheitsrechts. Dies umfasst auch eine Sorgfalts- und Vorsorgepflicht im Energiesektor: Subventionen oder Genehmigungen für fossile Energieprojekte können demnach eine völkerrechtswidrige Handlung darstellen, wenn sie maßgeblich zum Klimaschaden beitragen.
Konkret heißt das: Staaten müssen nicht nur eigene Emissionen senken, sondern auch die Aktivitäten von Unternehmen im Rahmen ihrer staatlichen Sorgfaltspflicht regulieren. Ein Staat kann also verantwortlich gemacht werden, wenn er es unterlässt, die notwendigen regulatorischen oder gesetzlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Emissionen privater Akteure unter seiner Hoheitsgewalt wirksam zu begrenzen.
Darüber hinaus betont das Gutachten die internationale Kooperationspflicht der Staaten bei Maßnahmen gegen den Klimawandel untereinander. Die bisher eher freiwilligen Ansätze gelten nach Auffassung des IGH nun als rechtlich verpflichtend, nicht mehr nur als politisch wünschenswert. Erforderlich ist eine kontinuierliche und dauerhafte Zusammenarbeit bei der Umsetzung entsprechender Schutzmaßnahmen.
Verfehlter Klimaschutz wird zum Haftungsrisiko
Ein zentraler Punkt des IGH-Gutachtens: Bei völkerrechtswidrigen Verstößen könnten Staaten zur Wiedergutmachung verpflichtet werden – auch in Form finanzieller Entschädigungen. Voraussetzung ist ein nachweisbarer Klimaschaden etwa durch einen steigenden Meeresspiegel, Extremwetter oder den Verlust landwirtschaftlicher Flächen. Diese Einschätzung ebnet den Weg für internationale Klimaklagen von Ländern, die vom Klimawandel betroffen sind.
Neben großen Emittenten wie den USA, China oder den EU-Mitgliedsstaaten könnten auch Unternehmen im Energiesektor stärker unter Druck geraten, da die Staaten gesetzliche Sorgfaltspflichten künftig strenger umsetzen müssen – auch gegenüber Unternehmen. Förderstrategien, Investitionen in fossile Energien oder unzureichende ESG-Due-Diligence könnten künftig als rechtliche Risikofaktoren gewertet werden.
Auch wenn das Gutachten keine rechtlich bindende Wirkung hat, markiert das IGH-Gutachten einen Paradigmenwechsel im internationalen Klimarecht und gilt als wegweisend. Staaten und Energiekonzerne müssen Klimaschutz nicht nur ernst nehmen – sie müssen ihn rechtlich absichern.
„Das höchste Gericht der Welt hat uns ein mächtiges neues Instrument an die Hand gegeben, um Menschen vor den verheerenden Auswirkungen der Klimakrise zu schützen“, sagte die ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, in einem Statement.
© IWR, 2025
Tod durch Klimawandel: Echtzeitdaten belegen Anstieg der Hitzemortalität in 12 europäischen Städten während letzter Hitzewelle
Klimawandel bedroht Lebensräume: 26 Mio. Binnenvertreibungen durch Extrem-Wetter und Naturkatastrophen in 2023
19 Prozent Einkommensverlust weltweit: Schäden durch den Klimawandel übersteigen Vermeidungskosten mehrfach
EU-Klimawandeldienst: Monat März 2024 ist zehnter globaler Temperatur-Rekordmonat in Folge
WMO-Bericht: Indikatoren für den Klimawandel erreichen 2023 Rekordwerte
BBH Consulting AG sucht (Junior) Consultant (m/w/d) im Bereich der Netzentgeltregulierung
Original PM: Repowering und Ausbau: Windpark Sonnenberg V wird zum Vorzeigeprojekt – ENERTRAG und EBERT schließen Kooperationsvertrag
BBH Consulting AG sucht (Junior) Consultant (m/w/d) im Bereich der Netzentgeltregulierung
Pressemappen - mit Original-Pressemitteilungen
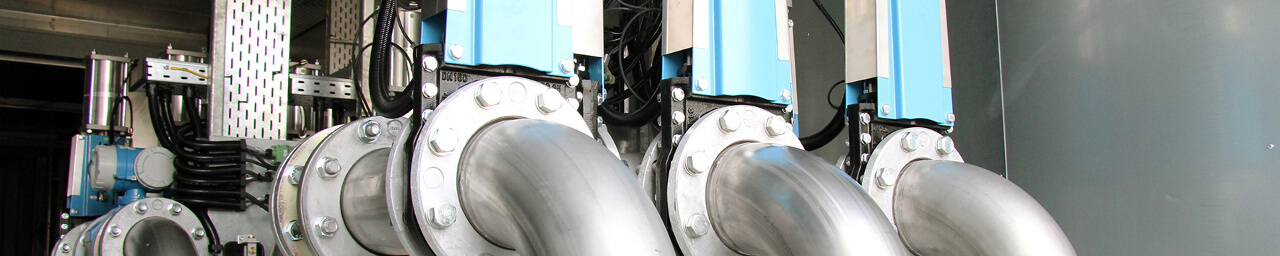
 © Adobe Stock
© Adobe Stock Artikel teilen / merken
Artikel teilen / merken


